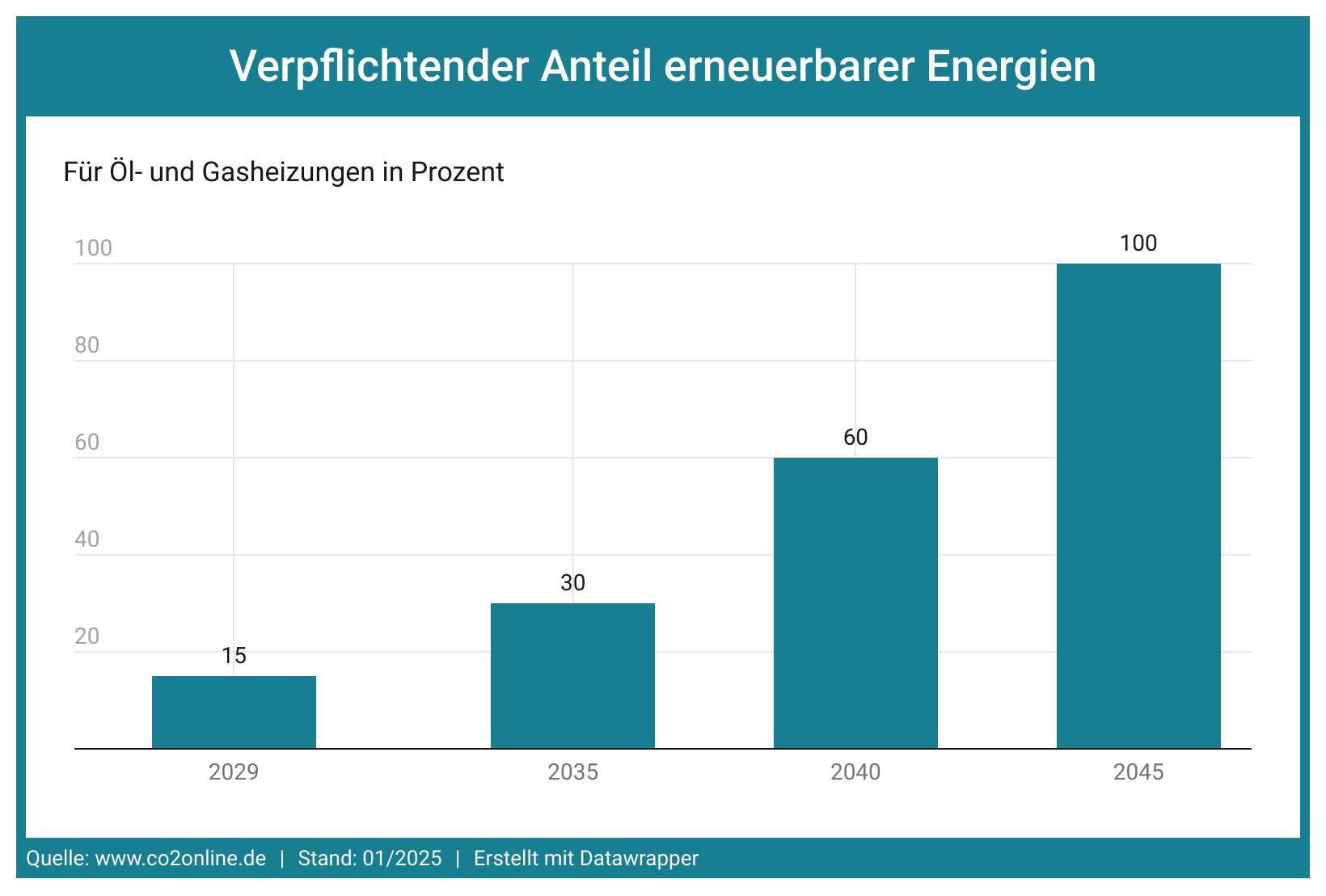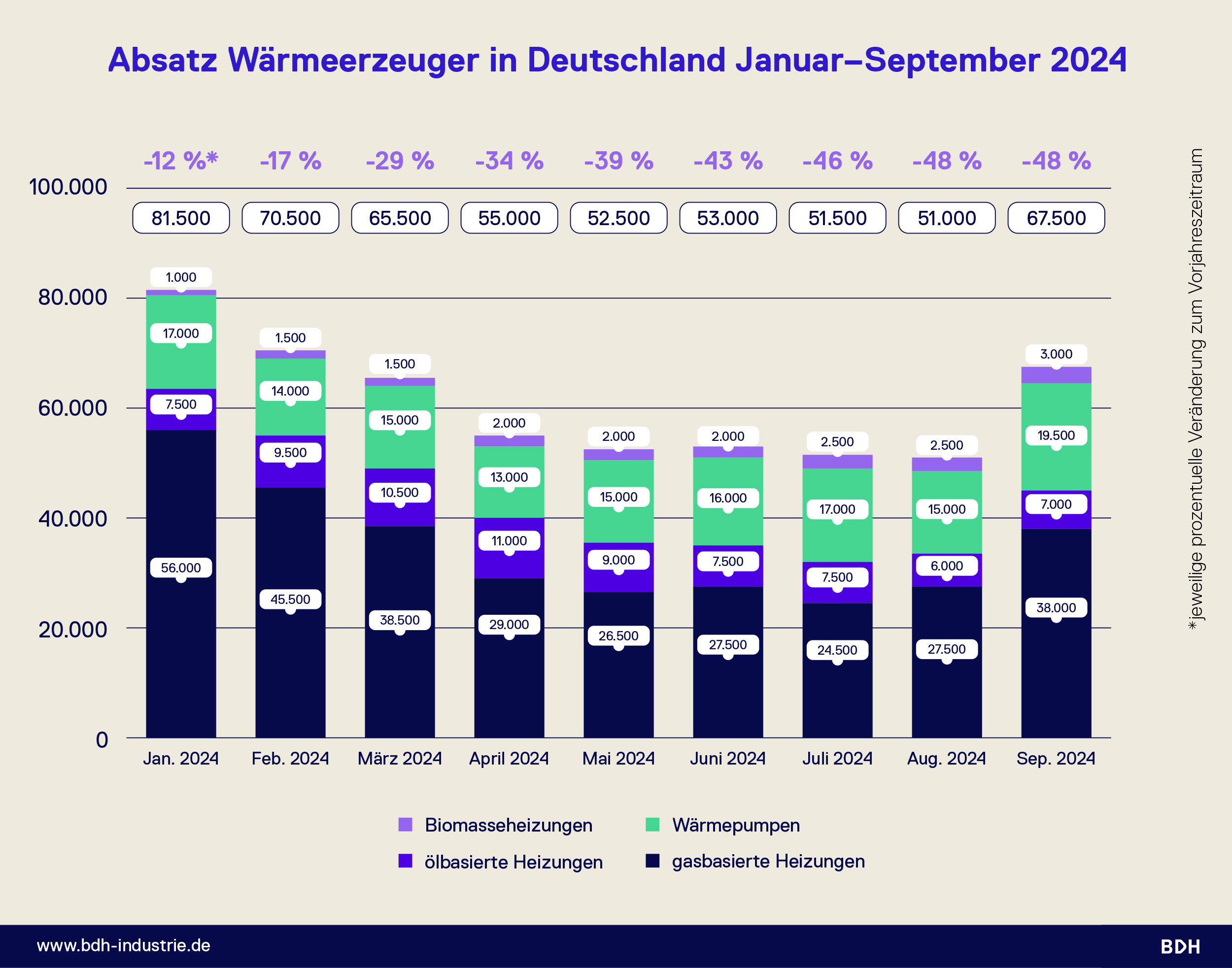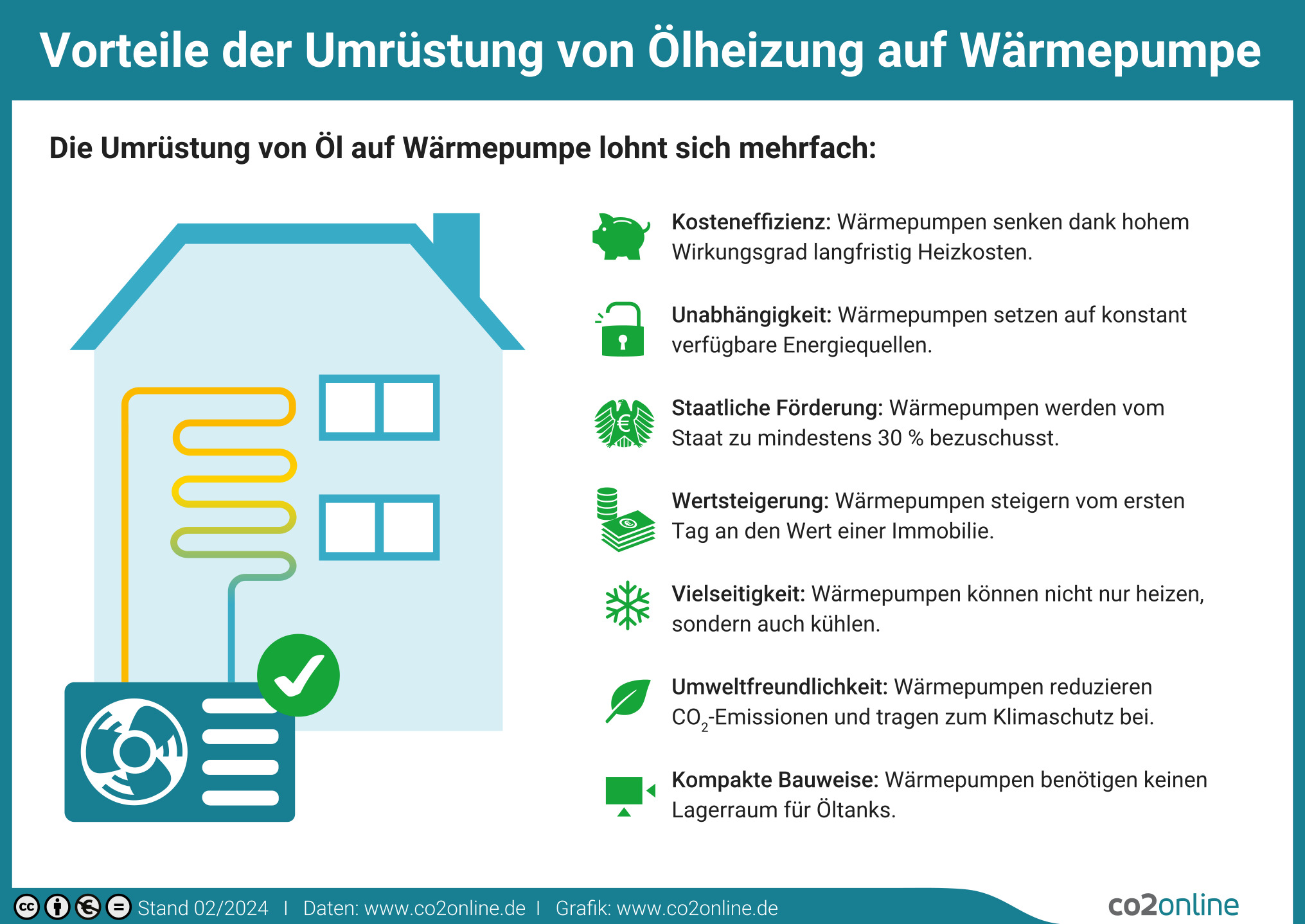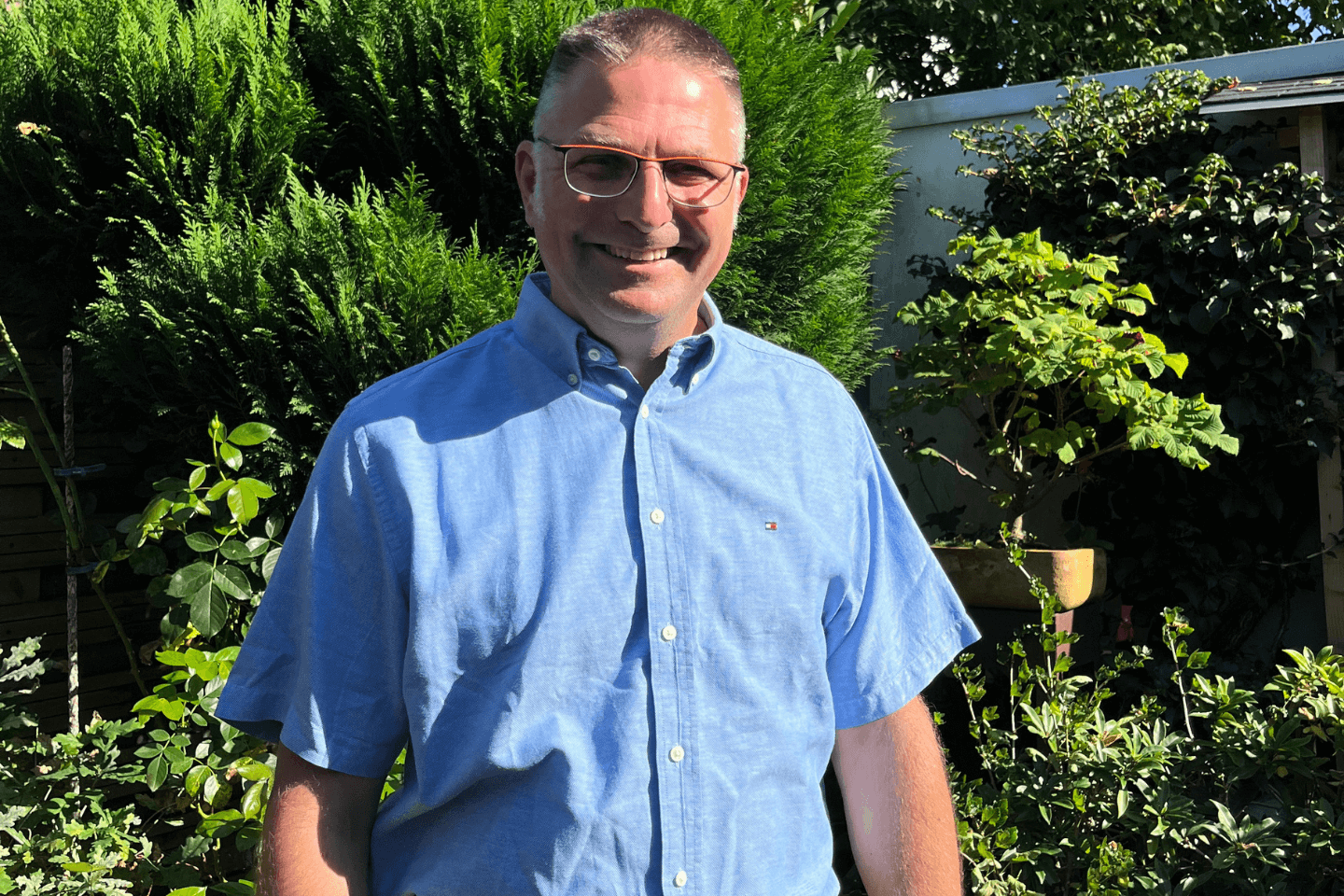Erfahrungen mit der Umrüstung von Ölheizung auf Wärmepumpe
Der 56-jährige Lars wohnt mit seiner Frau und den Schwiegereltern in einem Zweifamilienhaus im Rhein-Sieg-Kreis, 280 m², Baujahr 1970. Die drei Kinder sind bereits ausgezogen. 2022 stand bei ihm der Heizungstausch auf der Agenda: Ölheizung raus – Wärmepumpe rein.
Die Auswahl eines passenden Wärmepumpen-Anbieters war für Lars eine Herausforderung. Aber auch alles drum herum dauerte viel länger als gedacht. Im Sommer 2023 schließlich ging die neue Heizungsanlage, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 14 kW und einem 750-Liter-Pufferspeicher, in Betrieb.